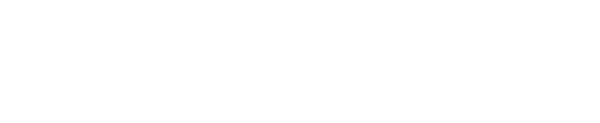Mit ihrer Schwester gründete Eda Öztürk „MIKRASS“ – ein Netzwerk und Medien-Start-up von und für Journalist*innen mit Migrationsgeschichte. Im Gespräch erzählt sie, warum Wut ein Motor für Wandel ist, was „Street Credibility” im Journalismus bedeutet und wieso Redaktionen Rassismus konsequent benennen und neue Narrative zulassen müssen.
Von Pauline Tillmann, Konstanz
Zusammenfassung:
Eda Öztürk hat mit ihrer Schwester das Netzwerk MIKRASS gegründet, um Journalist*innen mit Migrationsgeschichte zu stärken. Statt Tokenismus setzt sie auf neue Narrative, „Street Credibility“ und Community-Journalismus. Wut versteht sie als Motor für Wandel. Mit MIKRASS will sie migrantische Perspektiven in den Medien sichtbar machen, rassistische Strukturen aufbrechen und über Plattformen wie TikTok empowernde Geschichten erzählen.
Was hat dich motiviert, MIKRASS zu gründen?
Diversität in deutschen Redaktionen ist immer noch ein Problem. Das löst ein Gefühl von Ungerechtigkeit und Wut aus. Ich finde, weibliche Wut ist ein Motor für Revolutionen. Für mich ist MIKRASS etwas, das es noch nicht gibt. Es ist eine BPoC-Produktionsfirma und ein Kollektiv. Dass wir die Ersten sind, hat strukturelle Gründe. Als Bildungsaufsteigerin bin ich bereit, Dimensionen aufzubrechen. Dass wir bei der re:publica 2025 gehört wurden, ist der Beweis, dass es uns mehr denn je braucht.
Auch bei DEINE KORRESPONDENTIN liegt uns das Thema Diversität am Herzen. Wir versuchen immer wieder, Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen zu zeigen: Frauen mit Behinderung, Frauen mit Migrationshintergrund usw. Wir alle wissen, dass viel zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien arbeiten.
Da hast du Recht! Fünf Prozent der Journalist*innen in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte. Dabei leben wir in einer Einwanderungsgesellschaft. Im Vergleich dazu haben etwa 30 Prozent der Menschen in Deutschland Migrationsgeschichte – also sechsmal so viel wie in Redaktionen. Bei den Posten der Chefredakteur*innen sieht es nicht viel besser aus.

Wie viele seid ihr denn aktuell bei MIKRASS? Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Bei MIKRASS sind wir gerade zu zweit: meine Schwester Sara und ich. Aus Wut und Frust haben wir eine WhatsApp-Gruppe mit inzwischen mehr als 130 Mitgliedern bundesweit erstellt. Wir sehen diese Gruppe als Empowerment-Instrument, denn es geht nicht nur mir so, dass ich ein Netzwerk von Gleichgesinnten brauche. Wir Migras – also Menschen mit Migrationsgeschichte – brauchen das in einer von weißen dominierten Medienlandschaft wohl mehr als alles andere.
Wir schaffen damit einen Ort, an dem man Wut rauslassen, aber auch heilen und Halay tanzen kann. Es ist, um ehrlich zu sein, ein Selbstläufer geworden und nimmt immer mehr Struktur an. Ich glaube, der Bedarf ist definitiv vorhanden, und jetzt sind wir dabei, ein entsprechendes Angebot auszuformulieren.
Das heißt, ihr seid momentan auch dabei, euch zu formalisieren? Also einen Verein zu gründen, oder eine UG – und dem Ganzen eine Körperschaft zu geben?
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass Vereine in Anbetracht der politischen Situation gerade nicht so zielführend sind. In der Kulturlandschaft merkt man, dass Vereine, die sich für Diversität oder queere bzw. muslimische Identitäten einsetzen, die Ersten sind, die von finanziellen Kürzungen betroffen sind. Die Bedingungen werden politisch immer schwieriger, um es diplomatisch auszudrücken. Wir sind gerade an unterschiedlichen Förderungen dran und wollen ein Medien-Start-up gründen.
Ich habe das VORLAUT Kollektiv in Wien mitgegründet, es mit Herzblut hochgejazzt und jahrelang ehrenamtlich gearbeitet. Jetzt möchte ich etwas gründen, an dem ich auch mitverdiene. Wir müssen viele, viele strukturelle Barrieren durchbrechen, aber ich habe eine starke Community im Rücken und bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Du bezeichnest dich selber als Journalistin mit „Street Credibility“. Was bedeutet das in Hinblick auf deine Arbeit?
Ich komme aus einer Hartz-IV-Familie. Ich habe nie wirklich gelernt, wie man mit Geld umgeht, denn wir hatten einfach keines. Salopp gesagt komme ich von der Straße. „Street Credibility“ bedeutet für mich Lebensnähe. Ich bin nah an den Communities. Meine Eltern sind in Serbien geboren und in der Türkei aufgewachsen. Sie haben mich im Ruhrpott, in Dortmund, bekommen. Ich bin überall sehr gesellig unterwegs, was sich auch total gut anfühlt. Grundsätzlich bin ich von community-basiertem Journalismus überzeugt und glaube, dass wir Perspektiven und Storytelling neu denken müssen.
Welche Rolle spielt TikTok dabei?
Auf TikTok erzählen Migrant*innen von ihren Erfahrungen, zum Beispiel mit Rassismus. Diese Empowerment-Geschichten werden von den großen Medien aber nicht aufgegriffen, weil sie die Sprache und Lebensrealität dieser Menschen nicht kennen. Ich habe bei ZEIT ONLINE gearbeitet und habe mich ehrlich gesagt der Putzkraft oder dem Rezeptionisten näher gefühlt. Denn: Du fühlst kennst all die Probleme. Genau das ist für mich „Street Credibility“ – und diese Diversität fehlt in den Medien noch immer. Es gibt kaum jemanden, der aus der Arbeiterklasse kommt oder queer ist. Ich checke einfach nicht, wie man Millionen von Euro in neue Formate investiert und es nicht schafft, die Bäckerin zu fragen, was sie interessiert und welche Sorgen sie hat. Das ist für mich eine Haltung, ein Vibe, die Art und Weise, wie ich spreche. Ich hatte zu Hause nie das Gefühl, dass Medien für mich gemacht sind. Diese Strukturen sind nicht so gemacht, dass wir dort arbeiten können. Deshalb brauchen wir neue Strukturen.
Wie hat dich denn dein Aufwachsen als Arbeiter*innenkind im Ruhrgebiet geprägt, Eda? Hast du deshalb bestimmte journalistische Schwerpunkte?
Ich bin Migrantin und Arbeiter*innenkind, das heißt, ich bin mit mehrfachen Zuschreibungen konfrontiert. Armut ist scheiße, da gibt es nichts schönzureden. Und sie ist nichts, woraus man sich einfach befreien kann – sie prägt dich, egal wie erfolgreich du wirst. Aber genau aus dieser Erfahrung habe ich die Fähigkeit entwickelt, aus wenig viel zu machen. Ich war die beste Ressourcenmanagerin. Ich hatte die größte Empathie. Ich hatte die besten Skills, Netzwerke zu schaffen. Das sind Dinge, die man in einem solchen Umfeld einfach lernt. Gib mir fünf Euro, und ich produziere eine Straßen-Talkshow mit dem Geld. Es war übrigens die erste dieser Art in Österreich. Wir dachten, weil wir so innovativ waren, gehört uns die Welt. Am Ende hatten wir sogar eine Kooperation mit dem ORF.
Ich habe mir den Journalismus nicht als Beruf ausgesucht. Für mich bedeutet arbeiten, sich die Hände schmutzig zu machen. Mein Vater arbeitet auf der Baustelle, meine Mutter hat drei Kinder und spricht kein Deutsch. Nichtsdestotrotz hat sie für uns Türen eingerissen – und deshalb habe ich das Gefühl, das könnte ich auch. Daran, dass man gemütlich in ein Café sitzt und den Laptop aufklappt, um ein Interview zu führen, muss ich mich erst einmal gewöhnen. Ich habe mich hochgearbeitet, mit blutigen Nägeln und Knien. Es ist ein Überlebenskampf, bei dem man unzerstörbar wird. Jetzt bin ich mit allen Wassern gewaschen, und egal, was passiert: Ich bin extrem widerstandsfähig.
Was hätte dir denn geholfen? Viele nennen die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali als Aushängeschild. Dabei ist sie eine von ganz Wenigen, die es bis ganz nach oben geschafft haben.
Es gibt mittlerweile einige Ausschreibungen von Medienhäusern, die sich zum Beispiel explizit an Arbeiterkinder richten. Das war vor zehn Jahren, als ich 22 war, noch nicht der Fall. Es hätte mir geholfen, wenn ich gespürt hätte, dass diese Räume auch für mich gemacht sind. Dass ich dort einen Platz habe und nicht dumm bin. Ich hatte immer einzelne Menschen, die mir die Tür geöffnet und gesagt haben: ‚Geh schnell rein, sonst klappt die große Stahltür gleich wieder zu.‘ Aber das sind Zufälle. Ich hatte einfach Glück, dass ich die richtigen Leute an den entscheidenden Stellen getroffen habe. Mir hätte Anerkennung geholfen, dass meine Perspektive und meine Lebensrealität relevant sind. Leider sind die Strukturen in Medienhäusern weitgehend weiß und heteronormativ geprägt, sodass immer die gleichen Leute eingestellt werden und diverse Stimmen gar nicht gewollt sind. Ich selbst war ein Token, den man genommen hat, um nach außen zu signalisieren: Wir sind divers. Aber am Ende ist das nur Fassade.
Warum tun sich denn Medien mit diversen Perspektiven so schwer?
Kurzer Einschub: Es sind nicht alle Medien. Man kann nicht pauschalisieren, denn es gibt Ausnahmen wie die Deutsche Welle oder Cosmo vom WDR. Aber es gilt für sehr viele Medien. Ich weiß es wirklich nicht, ehrlich gesagt. Wenn man die Redaktion verlässt und auf die Straße geht, sieht man sofort Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Es ist ein System, das über viele Jahrzehnte so gewachsen ist, dass schwer zu verändern ist. Meiner Meinung nach braucht es einen Kulturwandel. In Redaktionen herrscht oft eine Kultur der Angst. Viele trauen sich nicht, etwas zu sagen, weil die Hierarchien vielerorts noch sehr stark und starr sind. Viele Mitarbeitende, zum Beispiel Community-Manager oder Social-Media-Manager, hätten Bock auf Diversität. Aber es scheitert oft an den Führungskräften. Man merkt, dass es eine Kluft gibt – und die liegt eher an der Führung als an der Belegschaft.
Und wie versucht ihr bei MIKRASS, diversere Perspektiven sichtbar zu machen? Wie geht ihr konkret vor?
Wir haben viele unterschiedliche Pläne, die davon abhängen, was konkret gefördert wird. Aktuell haben wir ja noch kein Geld. Wir geben erst einmal nur Workshops, die wir selbst konzipiert haben, zu KI und TikTok-Storytelling. Aber bislang sind wir noch ins Produzieren gekommen. Das heißt, solange wir keine Förderung erhalten, können wir nichts umsetzen bzw. produzieren. Ich möchte das nicht einfach ehrenamtlich machen. Ich habe mir schon einmal bewiesen, dass ich vieles ohne Geld machen kann. Das brauche ich nicht noch einmal. Wir versuchen, unsere Vision zu verbreiten, und danach kommen wir hoffentlich irgendwann ins Machen. Es gibt unzählige Geschichten, die noch nie erzählt worden sind. Es sind Narrative, die in einer postmigrantischen Gesellschaft neu gebaut werden müssen. Ich freue mich sehr darauf, endlich eigenen Content erstellen zu können.
Welche Plattformen wollt ihr in erster Linie bespielen?
Für uns ist Instagram die Grundlage, also als Ankündigungsplattform und als Ort, an dem wir uns ausleben können. Den Fokus werden wir aber auf TikTok legen, weil das ein echter Game-Changer ist und wir dort mit allen Regeln, Geschichten zu erzählen, brechen können. Dort sind die Menschen, die wir brauchen, und die schon selbstbestimmt ihre Geschichten erzählen. Bislang hört ihnen niemand zu – aber wir wollen zuhören.
Über TikTok könnt ihr euch eine Reichweite aufbauen, aber nicht monetarisieren. Wie stellt ihr euch die Finanzierung eures Start-ups vor?
Nicht primär über die Plattformen. Wir denken eher an projektbasiertes Arbeiten mithilfe von Förderungen. Wikipedia hat zum Beispiel ein Reshape-Programm, bei dem kleinere Projekte gefördert werden, um marginalisiertes Wissen zu institutionalisieren. Aber klar, die Finanzierung ist nach wie vor ein offener Punkt. Da bin ich auf Leute wie dich angewiesen, die schon viel ausprobiert haben und ihr Wissen mit mir teilen.
Es ist nachgewiesen, dass Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Hass im Netz betroffen sind. Manche zeigen sich deshalb auch bewusst nicht mit Gesicht, um sich dem nicht auszusetzen. Wie gehst du damit um, dass du – als Frau und Migrantin – eine favorisierte Zielscheibe für solche Angriffe bist?
Du hast absolut Recht! Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte werden häufiger angefeindet. Hass im Netz ist im Moment extrem toxisch. Ich habe auf TikTok rechte Gewalt thematisiert – vom Mauerfall bis Hanau. Und da war auch mit Gesicht als Hostin auf TokTok. Das hat super eingeschlagen, wir bekamen einen Preis von der Bundeszentrale für politische Bildung, und die Community stand hinter mir. Ich glaube, es ist wichtig, sich präventiv einen Plan zu machen. Man sollte in den Redaktionen kommunizieren, dass man ggf. psychologische Betreuung benötigt. Man braucht Kontakte bei der Polizei. Also insgesamt braucht man so etwas wie einen „Ablaufplan“, der nach Eskalationsstufen gestaffelt ist. Und ich persönlich gehe so damit um, dass ich nie alleine aufgetreten bin und Strategien für Gegenrede entworfen habe.

Bei dem re:publica-Panel „Von Sensation zur Sensibilität? 30 Jahre Berichterstattung über Rassismus“ hat Eda Öztürk gemeinsam mit Sara Öztürk, Heike Kleffner und Cihan Sinanoğlu über das Thema Rassismus in den Medien und der Gesellschaft gesprochen. Die ganze Stunde kann man hier nachhören: https://re-publica.com/de/session/von-sensation-zur-sensibilitaet-30-jahre-berichterstattung-ueber-rassismus
Was ist das Wichtigste?
Das Bewusstsein zu schärfen, dass die Hater in der Minderheit sind. Sie sind am Ende gar nicht so viele, aber sie sind extrem laut. Das hilft mir, mich da durchzunavigieren. Schön war auch zu sehen, dass ich in den Kommentarspalten nicht allein war. Es gab viele, die mich verteidigt haben. Wichtig ist auch, sich zu überlegen: Wann poste ich etwas? Möchte ich mein Wochenende damit verbringen, mich dem Hass zu stellen, oder mache ich das lieber am Montag und nutze das Wochenende zum Entspannen? Ich habe das Gefühl, dass große Medienhäuser da ziemlich blank sind – sie haben eine Netiquette, aber das war’s. Einen Ablaufplan haben die meisten nicht.
Es gab mal ein Format namens Hate Poetry, bei dem Journalist*innen wie Deniz Yücel (taz), Özlem Gezer (DER SPIEGEL) oder Yassin Musharbarsh (DIE ZEIT) die Leserbriefe, die sie bekommen haben, öffentlich vorgelesen haben. Damit haben sie den Hass, der auf sie einprasselte, wieder in den Orbit hinausgeschickt und empfanden das als eine Art „Katharsis“. Wie siehst du das?
Bislang habe ich noch keine Morddrohungen bekommen. Aber als ich auf TikTok etwas über Walter Lübcke und dann auch den rassistischen Anschlag in Hanau gepostet habe, wurde ich in den Kommentaren persönlich angefeindet. Teilweise musste ich das Handy dann meiner Schwester übergeben, die die Kommentare für mich geschrieben hat. Ich habe also gar nicht alles selber gelesen.
Ich bin kein großer Fan davon, Hass zurückzuspielen. Am Ende reproduziert das ja auch nur Hass. Grundsätzlich würde ich mir einen stärkeren Fokus auf Gegenrede wünschen. Wir sollten uns mehr damit beschäftigen, welche Gegenrede funktioniert und welche nicht, und wie wir es schaffen, nicht noch mehr Hass in die Welt zu bringen.
Woher kommt der Name MIKRASS?
„Migras” ist eine positive Selbstbezeichnung für Menschen mit Migrationsgeschichte, vor allem auf TikTok. „Krass“ ist ein Ausdruck von Empowerment. Das ist das genaue Gegenteil vom Imposter-Syndrom, mit dem viele Migra-Journalist*innen zu kämpfen haben. Nach dem Motto: „Hey, wir sind krass und feiern das!“ Es ist Ausdruck unserer Sprache und Identität. So wie ich spreche, ist es weder elitär noch wissenschaftlich. Wir wollen leben, wie wir arbeiten, und wir reden, wie wir lieben. Das heißt, ich habe – trotz Masterabschluss – keine Lust, elitäre Sprache zu adaptieren. Und ehrlich gesagt wollen das viele Leute da draußen auch nicht. Das bekomme ich zumindest immer wieder gespiegelt. Wir kommen weiter und schneller ans Ziel, wenn wir direkt und ehrlich kommunizieren.
Ein großer Erfolg war sicher auch unsere Session bei der re:publica, der größten Digitalkonferenz Europas, in der du und andere über Rassismus gesprochen haben. Was können Redaktionen davon direkt umsetzen?
Bei der Session haben wir auf unterschiedliche Ebenen geachtet: Journalismus, Wissenschaft und die Perspektive von Betroffenen. Das erste Learning ist: Rassismus sollte öfter und klarer benannt werden. Lange Zeit wurde der Fokus auf die Täter gerichtet und von Fremden- und Ausländerfeindlichkeit gesprochen. Dabei sind es oft gar keine Ausländer, sondern Deutsche. Daneben muss man sich die Strukturen anschauen, also unter anderem das Thema Polizeigewalt.
Und als drittes Learning würde ich sagen: Geht auf TikTok! Die Plattform hat so viel Potenzial und ist eine hervorragende Rechercheplattform. Okay, vielleicht bin ich voreingenommen. Aber es ist wirklich eine gute Möglichkeit, mehr über Themen aus unserer Perspektive, also der Perspektive von Migrant*innen, zu erfahren.
Abschließend: Was ist deine Vision für die Zukunft? Wo möchtest du MIKRASS in den nächsten drei Jahren hin entwickeln?
Wenn man immer so beschäftigt ist, kommt man gar nicht dazu, darüber nachzudenken, wohin man will. Ich bin sehr nüchtern. Das heißt, wir können die Strukturen nicht innerhalb von drei Jahren tiefgreifend verändern. Aber wir werden daran arbeiten, eine Redaktion aufzubauen, die eigene Themen umsetzt und vielleicht mit öffentlich-rechtlichen Anstalten zusammenarbeitet. Wir wollen neue Narrative in die Welt setzen. Aktuell ist das Wort „Islam” zu 98 Prozent negativ konnotiert. Die meisten Menschen verbinden damit Krieg und Terror. Dabei sollten wir endlich die Perspektive verändern – weg von den Klischees, hin zur Wirklichkeit.
Mehr über Eda Öztürk:
Eda Öztürk ist Journalistin, rassismuskritisch und klassenbewusst. Als Arbeiter*innenkind hat sie sich ihren Platz in den Medien erkämpft – vom ORF über ZEIT ONLINE und funk bis zur ARD, wo sie die Debattenkultur mitprägte. Mit dem Kollektiv VORLAUT brachte sie migrantische Perspektiven in preisgekrönte TikToks, Straßen-Talkshows und Reportagen.
2025 gründete sie MIKRASS – ein migrantisches Netzwerk für Journalismus, Social Media und Strategie. Zudem berät sie Redaktionen im Projekt „BetterPost“ der Neuen deutschen Medienmacher*innen zu Berichterstattung über die Einwanderungsgesellschaft.