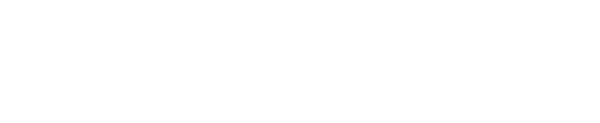Auf der Taipei Pride Parade im Oktober feiert Taiwan seine Fortschritte bei LGBTQ-Rechten. Es hat 2019 als erstes Land in Asien die Ehe für alle eingeführt. Doch das hastig erlassene Gesetz hat einige blinde Flecken. Die betreffen vor allem binationale Paare.
Zusammenfassung:
Taiwan gilt als LGBTQ-Vorreiter in Asien, doch binationale Regenbogenfamilien wie die von Anna und Sam kämpfen weiterhin um Gleichstellung. Ihre Tochter Jupiter erhält trotz taiwanischer Mutter keine Staatsangehörigkeit. Anwältin Victoria Hsu kämpft dafür, gesetzliche Lücken zu schließen, die queere Eltern benachteiligen. Der Fall zeigt: Echte Gleichstellung braucht mehr als symbolische Gesetze – sie muss im Alltag ankommen.
Von Carina Rother und Dinah Gardner, Taipei
Ein windiger Morgen mitten im sonst so heißen taiwanischen Sommer. Zwei Frauen nehmen die Stufen zu einem gläsernen Kastenbau, dem Shilin Bezirksgericht in Taipei. Zwischen ihnen ein kleines Mädchen, zwei Jahre alt und noch etwas unsicher auf den hohen Stufen. Ihre Hände halten die ihrer Mütter, auf jeder Seite eine. Wir nennen sie Jupiter, und ihre Mütter Anna und Sam. Sam ist Taiwanerin, Anna kommt aus Amerika.
Um die Privatsphäre ihrer Tochter zu wahren, wollen sie anonym bleiben. Zumindest so lange, bis Taiwans Rechtsprechung nachgezogen hat und ihre Tochter vor dem Gesetz genauso behandelt wird wie das Kind heterosexueller Eltern. Dafür gehen sie gegen das taiwanische Innenministerium vor Gericht.

Ein sicheres Land für Regenbogenfamilien
Dabei hat Taiwan in Sachen Gleichberechtigung schon viel erreicht. Dass gleichgeschlechtliche Paare in Taiwan heiraten können, wurde 2019 in einem Sondergesetz verankert. Es war ein großer Schritt für Taiwan. Das Land bezeichnet sich gern als das „freieste in Asien“, und war das erste in der Region, das die Ehe für alle umgesetzt hat. Auch für Anna und Sam war es ein Durchbruch. Sie hatten sich online kennengelernt, nachdem Anna 2015 nach Taiwan gezogen war. „Ich wusste ab dem ersten Treffen, dass ich sie heiraten wollte“, erzählt Anna.
Vier Jahre später konnten sie den Wunsch wahr machen; die gemeinsame Tochter folgte wenige Jahre später mit Hilfe von einer Samenspende. Das Paar berichtet positiv von ihren Erfahrungen als queere Familie in Taiwan. „Wir sind bisher meistens auf freundliche Neugier gestoßen“, sagt Anna, die ursprünglich aus dem konservativen Texas stammt. Dort würde sie sich mit ihrer Familie nicht so sicher fühlen, sagt sie – ein Grund, warum Anna mit Frau und Tochter noch nie ihre Heimat besucht hat. In Taiwan leben sie im Alltag unbesorgt.
Nur die rechtliche Lage bereitet ihnen Kopfschmerzen. „Blinde Flecken“ im Gesetz, nennen sie die bestehenden Ungleichheiten, die schrittweise ausgebessert werden müssten. Einer davon betrifft ihre Tochter, die nach geltendem Recht keinen Anspruch auf taiwanische Staatsangehörigkeit hat. Für Anna, die amerikanische Mutter, und die, die Jupiter zur Welt gebracht hat, ist das unbegreiflich: „Ihre Mutter ist Taiwanerin, wie kann sie keine Taiwanerin sein?“, sagt sie.
Denn wenn gleichgeschlechtliche Paare mit Hilfe einer Samenspende oder Leihmutterschaft im Ausland ein Kind bekommen, wird nur das leibliche Elternteil von Taiwans Behörden anerkannt. Das andere Elternteil muss den langwierigen und teuren Prozess der Stiefkindadoption durchlaufen, bevor es elterliche Rechte erhält.
Bei Sam und Jupiter hat es elf Monate gedauert – eine Zeit, in der Sams Beziehung zu ihrer Tochter rechtlich in der Schwebe war. Denn das adoptierende Elternteil hat während des laufenden Verfahrens keinen Anspruch auf Sorgerecht – im Falle von Trennung, Scheidung, oder Tod des leiblichen Elternteils fatal. Deutschland handhabt es ähnlich: Hier dauert eine Stiefkindadoption durchschnittlich sechs bis zwölf Monate, allerdings geben deutsche Adoptiveltern automatisch ihre Staatsangehörigkeit weiter.

Keine Staatsangehörigkeit trotz Stiefkindadoption
Sam und Jupiter wird das verwehrt. Nach taiwanesischem Recht kann ein Adoptivelternteil die taiwanesische Staatsangehörigkeit nicht weitergeben, es sei denn, das Kind gibt seine bestehende Staatsangehörigkeit auf, in diesem Fall die amerikanische. Da Anna und Sam zur ersten Generation gleichgeschlechtlicher Paare gehören, die in Taiwan geheiratet und eine Familie gegründet haben, ahnten sie nicht, dass dies passieren könnte. Ohne taiwanesische Staatsangehörigkeit hat Jupiter auf vieles kein Recht: Von Kindergeld über Wahlrecht bis zu reduzierten Studiengebühren, wenn sie älter ist.
Ihre Mütter sind erschöpft von jahrelangen Amtsgängen, Rechtskosten und Ungewissheit. „Wären wir in der gleichen Konstellation als heterosexuelles Paar, gäbe es dieses Problem nicht“, sagt Anna. Bei heterosexuellen Ehepaaren erhalten beide Partner*innen automatisch das Recht auf Elternschaft, unabhängig von der genetischen Verwandtschaft. Sie haben außerdem Zugang zu In-vitro-Fertilisation (IVF) und können Samen- und Eizellenbanken nutzen – ein Recht, das gleichgeschlechtlichen Paaren nach dem geltenden IVF-Gesetz in Taiwan verwehrt bleibt.
Sam, Jupiters taiwanische Mutter, ist trotzdem optimistisch. Sie findet, dass LGBTQ-Rechte in Taiwan seit der Ehegleichstellung 2019 auf immer mehr Akzeptanz in der Gesellschaft treffen. Nur: Die Gesetzeslücken müssten geschlossen werde. „Ich hoffe, dass sich das Recht durch die Lösung unseres Falls ändert.“ Während sie vor dem Gerichtssaal warten, trifft die Frau ein, die Regenbogenfamilien wie Sams und Annas in Taiwan erst möglich gemach hat – Victoria Hsu.
Eingeschränkte Rechte waren politisch gewollt
Die Anwältin hat gemeinsam mit ihren Mitstreiter*innen die Verfassungsklage vorgebracht, die in Taiwan den Weg für die gleichgeschlechtliche Ehe geebnet hat. 2017 erging das Urteil des Obersten Gerichts, eine Beschränkung der Ehe auf heterosexuelle Paare sei menschenrechtswidrig. Das Gericht gab dem Gesetzgeber eine Zwei-Jahres-Frist, um die Ehe für Alle einzuführen. Anstatt das bestehende Eherecht im Zivilgesetz für gleichgeschlechtliche Paare anzupassen, beschloss das Parlament kurz vor Ablauf der Frist ein Sondergesetz.
Es handelt sich laut Victoria Hsu um ein separates und „sekundäres Gesetz“, das gleichgeschlechtlichen Paaren – im Vergleich zu den Rechten heterosexueller Paare – relativ eingeschränkte Freiheiten und Rechte einräumt. Dass binationale Paare diese Ungleichheiten besonders stark spüren, läge an Taiwans Rechtssprechung, die Ausländer*innen zusätzliche Hürden auferlegt.
Heute ist sie gekommen, um Jupiters Recht auf taiwanische Staatsangehörigkeit vor Gericht einzuklagen. Mit Jeans und Turnschuhen unter der Anwaltsrobe geht sie vor dem Verhandlungssaal noch einmal alle Argumente durch, bevor sie mit Sam, Anna und deren Tochter im Saal verschwindet. Es ist die erste Anhörung eines Falls, der sich Jahre ziehen könnte. Und Jupiters Fall ist nur einer von mehreren, derer sich Hsu mit ihrer Organisation „Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights“, kurz TACPR, seit 2019 angenommen hat, um die verbleibenden Lücken im Gesetz zu schließen.

„Eine Art Berufung“
Später, in Büro von TACPR, spricht Anwältin Victoria Hsu über ihren Kampf für Gleichstellung. „Es ist eine Art Berufung“, sagt Hsu, „und als lesbische Anwältin mit viel Erfahrung auch eine Pflicht.“ Das Kernteam der TACPR besteht aus vier Anwält*innen, die größtenteils pro bono – also ohne dafür Geld zu verlangen – arbeiten. Seit der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan kämpfen sie weiter gegen bestehende Gesetzeslücken.
Zu Beginnn stand gleichgeschlechtlichen Paaren in Taiwan nur die Stiefkindadoption offen. Taiwaner*innen mit Partner*innen aus Ländern, in denen es keine gleichgeschlechtliche Ehe gibt, waren davon ausgeschlossen, in Taiwan die Ehe zu schließen. Seit 2023 können gleichgeschlechtliche Paare in Taiwan gemeinsam adoptieren. Im selben Jahr wurden die Voraussetzungen für die Ehe mit Ausländer*innen angepasst, sodass nun alle Nationalitäten zur Ehe zugelassen sind – auch dank der Arbeit von Hsu und ihrem Team. Dass das Gesetz so viel Bedarf zur Nachbesserung enthielt, lag auch an dem gesellschaftlichen Klima, als es erlassen wurde, erklärt die Anwältin:
Hsu erklärt: „Die Regierung wollte nur das Nötigste tun, um dem Auftrag des Verfassungsgerichts nachzukommen. Das bedeutete, dass sie bewusst einen Unterschied zwischen gleichgeschlechtlicher Ehe und heterosexueller Ehe machte, um den homophoben Gruppen das Gefühl zu geben, dass es keine echte Ehe wäre.“ In den sechs Jahren seither hat sich die öffentliche Meinung nachweislich geändert.
Laut einer Regierungsumfrage vom Juni 2025 unterstützen heute rund 70 Prozent der Bevölkerung das Recht auf Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Die Zahl hat sich seit Einführung der Ehegleichstellung fast verdoppelt. Das liegt auch daran, dass die gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft geworden ist, sagt Hsu: „Viele LGBT-Paare haben geheiratet, und Taiwan ist immer noch Taiwan! Es ist nichts Verrücktes passiert!“
Die nächsten Schritte zur Gleichstellung
Nun geht es darum, die Gleichbehandlung von Kindern aus gleichgeschlechtlichen Ehen zu garantieren, und den Zugang zu Reproduktionsmedizin sicherzustellen. Auch bei den Rechten für Transpersonen sieht Victoria Hsu dringenden Handlungssbedarf: Um ihre Ausweispapiere an das empfundene Geschlecht anpassen zu können, brauchen Transmenschen in Taiwan aktuell zwei psychiatrische Gutachten, die ihre Identität bestätigen, sowie eine geschlechtsangleichende Operation, die mit einer Sterilisation oder Kastration einhergeht. In Deutschland wurden ähnliche Anforderungen erst im November 2024 mit dem Selbstbestimmungsgesetz endgültig aufgehoben.
Zumindest im Fall Jupiter – und künftigen Kindern in ihrer Situation – könnte es Hoffnung geben: Das Innenministerium hat mit einer neuen Rechtsinterpretation in einer ähnlichen Familienkonstellation einen Präzedenzfall geschaffen. Auf den will sich die Familie in der nächsten Verhandlung berufen. Die Mütter hoffen, dass ihre Tochter so endlich zu ihrem Recht kommt – als taiwanisch-amerikanisches Kind eines lesbischen Paars in Taiwan.

Du magst unsere Geschichten über inspirierende Frauen weltweit und willst uns AKTIV unterstützen? Darüber freuen wir uns! Entweder wirst du ab 5 Euro im Monat Mitglied bei Steady (jederzeit kündbar) oder lässt uns eine Direktspende zukommen. Wir sagen: Danke, dass du deinen Beitrag leistest, damit guter Journalismus entstehen und wachsen kann.