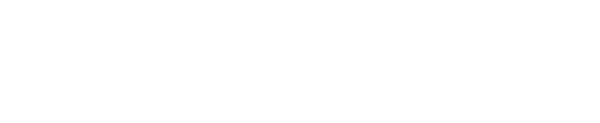Der Tourismus boomt in Spanien. Die Hotels in Touristenhochburgen wie Benidorm an der Costa Blanca sind voll, die Hotelbetreiber*innen machen gute Geschäfte. Die vielen Zimmermädchen, die Tag für Tag die Unterkünfte der Gäste putzen und aufräumen, profitieren davon nicht. „Las Kellys“, wie sie sich nennen, arbeiten unter Bedingungen, die an moderne Sklaverei grenzen.
Zusammenfassung:
In Spaniens Touristenhochburgen schuften Zimmermädchen oft unter extremem Druck, für wenig Geld und auf Kosten ihrer Gesundheit. Viele sind Migrantinnen, angestellt über Subunternehmen ohne Tarifschutz. Yolanda García kämpft mit ihrer Gruppe in Benidorm für bessere Bedingungen, Sichtbarkeit und Rechte. Trotz Rückschlägen gibt der gemeinsame Protest den Frauen Kraft – und eine Stimme in einem System, das sie lange ignoriert hat.
Von Heike Papenfuss, Valencia
Benidorm ist das Erfolgsmodell par excellence des modernen spanischen Tourismus. Ende der 50er Jahre legte der Bürgermeister Pedro Zaragoza dafür den Grundstein. Mit dem Moped soll er sich auf den Weg nach Madrid gemacht haben und bei einer Privataudienz von Franco die Erlaubnis bekommen haben, dass sich an den Stränden von Benidorm Touristinnen im Bikini sonnen dürfen. Ein Privileg, das im streng katholischen Spanien ansonsten verboten war.
Franco wusste, wie wichtig der Tourismus für Spaniens Wirtschaft war. Seine Entscheidung führte dazu, dass sich das beschauliche Fischerdorf am Mittelmeer in eine Touristenhochburg verwandelte. Wer sich Benidorm heute von der Autobahn aus nähert, sieht eine Skyline mit zahlreichen Hochhäusern: Apartments und Hotels, zunehmend auch von internationalen Ketten. Die Tourist*innen kommen das ganze Jahr über.
Nach der Pandemie hat sich die Hotelbranche wieder gut erholt. Ein Erfolg, an dem die vielen Zimmermädchen, die täglich für Sauberkeit und Ordnung sorgen, nicht teilhaben. In Spanien heißen sie „las Kellys“: ein Anagramm für „las que limpian“ (die, die saubermachen). „Wir sind unsichtbar. Wir sind niemand. Wir sind wie Ersatzräder, hat eine Kollegin einmal gesagt. Wenn ein Rad ausfällt, wird es einfach durch ein anderes ersetzt“, sagt Yolanda García – und bringt damit die ganze Missachtung der Interessen der Frauen zum Ausdruck.
Die Sprecherin der Gruppe der Kellys in Benidorm weiß, wovon sie spricht. Sie hat selbst zwölf Jahre lang als Zimmermädchen gearbeitet. Vor zwei Jahren hat sie aufgehört. Ihre Gesundheit spielte nicht mehr mit: Stress, chronische Rückenschmerzen, Tennisarm und das Karpaltunnelsyndrom sind Folgen ihres Berufes.

Zehn Minuten pro Zimmer
Bis zu 25 Zimmer müssen die Zimmermädchen Tag für Tag aufräumen und putzen. Yolanda García erinnert sich: „Die Uhr wird zu deinem größten Feind, denn du hast für jedes Zimmer eigentlich nur zehn Minuten Zeit. Du schuftest und schaust dabei ständig auf die Uhr, um zu sehen, ob du in der Zeit bist.“ Der Arbeitstag ist lang. Um sieben Uhr fangen die Frauen an zu arbeiten.
Zuerst werden die Gemeinschaftsflächen im Hotel geputzt: die Rezeption, das Restaurant, der Spa-Bereich und das Schwimmbad. Dann holt jede in der Wäscherei ihren Wagen, auf den sie Handtücher, Bettwäsche, Putzmittel und alles packt, was sie für die Zimmer auf ihrer Etage braucht.
Gegen neun Uhr ist eine halbe Stunde Frühstückspause: „Wenn man das so nennen will, denn da kriegst du von der Hausdame deinen Arbeitsplan und alle möglichen Anweisungen. Das ist keine wirkliche Pause, in der du in Ruhe deinen Kaffee trinkst und mit deinen Kolleginnen plauderst. Meistens haben wir uns nur etwas zu essen genommen und sind gleich los.“
Die Zeit drängt. Die Uhr tickt. „Solange du ein Zimmer nicht betreten hast, weißt du nicht, was dich erwartet“, sagt Yolanda García. Sie habe alles erlebt: Familienzimmer, deren Boden voller Sand vom Strandbesuch war, schmutzige Windeln oder Binden, die irgendwo im Zimmer liegen gelassen worden waren, auf dem Boden verstreute Essensreste, Erbrochenes in der Badewanne, an die Wand gespritzte Coca-Cola, herausgerissene Matratzen. „Ich war schon eineinhalb Stunden in nur einem einzigen Zimmer zugange. Man kann sich nicht vorstellen, in welchem Zustand manche Gäste die Zimmer hinterlassen.“
Tabletten, um den Alltag durchzustehen
Zehn Minuten. Die Uhr tickt. Wenn ein Zimmermädchen die ihr zugeteilten Zimmer nicht alle schafft, wird ihr das in manchen Fällen vom Lohn abgezogen. Die Hausdame, ihre Vorgesetzte, kontrolliert die Arbeit. Und das nicht unbedingt wohlwollend. „Ich habe erlebt, dass sie mit Finger über einen Bilderrahmen gefahren ist. Da lag noch ein bisschen Staub, da hat sie mich angeschrien“, erzählt Yolanda García. Einer rumänischen Kollegin habe die Vorgesetzte sogar den Kopf gegen die Badewanne geschlagen, weil sie diese angeblich nicht richtig sauber gemacht hatte.
Wenn die Frauen mit den Zimmern fertig sind, müssen sie alles aufräumen, die schmutzigen Handtücher und die Bettwäsche, den Müll. Alles muss wieder in die Wäscherei im Untergeschoss gebracht werden. Die Zimmermädchen dürfen nicht die Aufzüge der Gäste benutzen. Also warten sie mit ihren Wägen auf den Lastenaufzug, alle ungefähr zur gleichen Zeit. Manchmal habe sie eine halbe Stunde auf den Aufzug gewartet, bis sie vom 18. Stock in den Keller fahren konnte, erinnert sich García.
Kaum eine der Frauen übersteht diese Arbeit bis ins Rentenalter. Schon nach wenigen Jahren in diesem Beruf haben die meisten gesundheitliche Probleme. Sie leiden unter Rückenschmerzen, muskulären Entzündungen oder dem Karpaltunnelsyndrom, eine Nerveneinengung im Handgelenk. Sie bekommen Asthma oder Hautprobleme von den scharfen Putzmitteln. Nicht zu reden vom ständigen Stress und der damit einhergehenden psychischen Belastung.
Die meisten retten sich mit Antidepressiva oder entzündungshemmenden Mitteln durch den Alltag. Das spanische „Institut für Sicherheit und Gesundheit in der Arbeit“ veröffentlichte 2018 einen Bericht, demzufolge 65 Prozent der Frauen unter chronischen Schmerzen leiden, verursacht durch die große Arbeitsbelastung und den enormen Zeitdruck, unter dem sie stehen.

Mindestlohn für maximale Belastung
Im Jahr 2016 schlossen sich zunächst in Barcelona einige Zimmermädchen zusammen und gründeten den Verein „las Kellys“, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Yolanda García erfuhr über die sozialen Netzwerke von ihnen und gründete mit ein paar Mitstreiterinnen die Gruppe in Benidorm. Sie versuchen damit eine Lücke zu schließen, denn die Gewerkschaften kümmern sich kaum um die Probleme der Kellys.
Ein Großteil der Frauen ist nämlich nicht bei den Hotels selbst angestellt, sondern bei externen Firmen, die sich auf die Vermittlung von Putzkräften spezialisiert haben. Für sie gelten die von den Gewerkschaften verhandelten Tarifverträge nicht, auch der Betriebsrat eines Hotels ist für die Frauen nicht zuständig. Die Arbeit ist hart und die Entlohnung schlecht. Für einen Acht-Stunden-Tag in einem Hotel mit vier Sternen bekommen die Frauen monatlich 1.200 Euro brutto, weniger Sterne bedeuten weniger Geld. Sie verdienen den Mindestlohn.
Rund 4.000 Zimmermädchen gibt es in Benidorm. Die schlechten Arbeitsbedingungen haben sich herumgesprochen. Junge Spanierinnen wollen den Job nicht mehr machen. Es sind heute vor allem junge Frauen aus Lateinamerika, Marokko, Rumänien oder Bulgarien, die die Zimmer putzen. Viele sind froh, überhaupt einen Job zu haben. Aus Angst ihn zu verlieren, trauen sie sich nicht, sich gegen die schlechten Arbeitsbedingungen zu wehren. Oft kennen sie ihre Rechte nicht und wissen auch nicht, an wen sie sich wenden können.
In einem Manifest haben die Kellys formuliert, welche Verbesserungen sie sich für ihr Arbeitsleben vorstellen. Eine zentrale Forderung ist das Ende der Beschäftigung durch Subunternehmen, an deren Stelle die Hotels als Arbeitgeber treten sollen. Auf diese Weise würde der Tarifvertrag für die Hotellerie für sie genauso gelten wie für die anderen Beschäftigten der Branche. Bislang ist das nicht der Fall.
Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsbelastung regelmäßig von den Mitarbeitenden der entsprechenden staatlichen Stellen kontrolliert werden, um Missstände zu beheben. Weiterhin fordern sie ein Recht auf eine vorgezogene Rente ohne Abzüge und die Anerkennung ihrer berufsbedingten Krankheiten.

Ein Gefühl der Ohnmacht
Diese Anerkennung gibt es bisher so gut wie nicht. Manche Frauen ziehen vor Gericht, um auf Entschädigung zu klagen. Meist ohne Erfolg. Gloria Poyatos Matas, Richterin am oberen Gerichtshof auf Lanzarote, kennt das Problem. Auf einer Veranstaltung des „Instituto de las Mujeres“, einer öffentlichen Einrichtung, die zum Ministerium für Gleichstellung gehört, weist sie darauf hin, dass die spanische Justiz noch immer sehr chauvinistisch sei. Die spanische Berufsbezeichnung lässt zwar eine männliche und eine weibliche Variante zu, aber tatsächlich arbeiten fast durchweg Frauen als Zimmermädchen.
Ihre berufsbedingten Probleme würden nicht ernst genommen. Ein Geschlechterproblem, davon ist die Richterin überzeugt. Auch die Regelung des Arbeitspensums lässt sie nicht gelten. So würde ein Rezeptionist im Hotel nicht danach bezahlt werden, wie viele Gäste er an einem Tag bedient habe und ein Koch nicht danach, wieviel Gerichte er gekocht habe. Die Regelung, dass Zimmermädchen bis zu 25 Zimmer pro Tag zu putzen hätten, sei willkürlich und in keinem Tarifvertrag so vorgesehen.
Aus der Unsichtbarkeit herausgetreten
Es gibt wenige Stimmen, wie die von Gloria Poyatos Matas, die sich für die Rechte der Kellys einsetzen. Und die Hotels? Die soziale Unternehmensgruppe und spanische Blindenorganisation ONCE hat unter dem Namen ILUNION eine Hotelkette eröffnet. Sie wirbt mit ihrem sozialen Engagement und damit, dass sie auch Menschen mit Förderbedarf beschäftige. Zur Situation der Zimmermädchen in ihren Hotels wollten sie keine Auskunft geben.
Die Kellys sind aus der Unsichtbarkeit herausgetreten und haben ihre Arbeitsbedingungen öffentlich gemacht: mit Kundgebungen, Beiträgen in den sozialen Medien oder Gesprächen mit Politiker*innen. Grundsätzlich geändert hat sich nur wenig. Vereinzelt konnten einige Kolleginnen ihre Situation verbessern, Misshandlungen beenden oder unbezahlte Überstunden abwehren.
In manchen Hotels verbesserten Inspektor*innen der Arbeitssicherheit ergonomische Standards. Es sind kleine Schritte. „Manchmal bin ich weinend von der Arbeit nach Hause gegangen, vor lauter Ohnmacht.“, sagt Yolanda García. Das ist jetzt anders. Die Kellys haben das Schweigen gebrochen und kämpfen für ihre Rechte. Das gibt ihr Kraft.

Du magst unsere Geschichten über inspirierende Frauen weltweit und willst uns AKTIV unterstützen? Darüber freuen wir uns! Entweder wirst du ab 5 Euro im Monat Mitglied bei Steady (jederzeit kündbar) oder lässt uns eine Direktspende zukommen. Wir sagen: Danke, dass du deinen Beitrag leistest, damit guter Journalismus entstehen und wachsen kann.