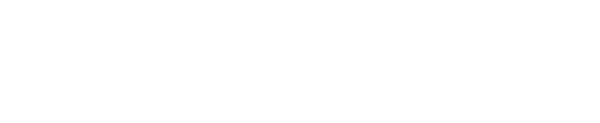Im März 2024 schrieb Frankreich Geschichte: Als erstes Land weltweit verankerte es das Recht auf Abtreibung in seiner Verfassung. In einer Zeit, in der in einigen Ländern reproduktive Rechte wieder massiv eingeschränkt werden, sendet Frankreich damit ein bewusstes Zeichen.
Zusammenfassung:
Frankreich hat als erstes Land weltweit das Recht auf Abtreibung in seine Verfassung aufgenommen – ein historischer Schritt für körperliche Selbstbestimmung. Initiiert von engagierten Politikerinnen wie Mélanie Vogel, sendet das Land damit ein starkes Signal gegen weltweite Rückschritte bei reproduktiven Rechten. Trotz juristischer Absicherung bleibt der Zugang besonders in ländlichen Regionen schwierig.
Von Anna Schütz, Montpellier
Am 4. März 2024 erhebt sich im prunkvollen Kongresssaal von Versailles, in dem das französische Parlament tagt, donnernder Applaus. Nach stundenlangen, teilweise hitzigen Debatten fällt eine Entscheidung, die Geschichte schreiben wird: Mit 780 Ja-Stimmen und nur 72 Gegenstimmen hat Frankreich soeben als erstes Land weltweit beschlossen, das Recht auf Abtreibung als verfassungsrechtlich geschützte Freiheit abzusichern.
Künftig heißt es in der Verfassung: „Die Freiheit der Frau, einen freiwilligen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, wird garantiert.“ Inmitten globaler Rückschritte bei reproduktiven Rechten setzt Frankreich damit ein klares Zeichen für körperliche Selbstbestimmung, juristischen Schutz und Gleichberechtigung. Was heute als historischer Meilenstein gefeiert wird, begann mit dem hartnäckigen Einsatz engagierter Frauen.

Vom Entwurf zum Durchbruch
Den Anstoß gab im Herbst 2022 die grüne Senatorin Mélanie Vogel, die einen ersten Entwurf zur Aufnahme der Abtreibungsfreiheit in die Verfassung vorlegte, motiviert unter anderem von der Einschränkung reproduktiver Rechte in den USA. Kurz darauf brachte Mathilde Panot, Fraktionschefin von „La France Insoumise“ in der Nationalversammlung, einen ähnlichen Vorschlag ins Parlament ein. Beide Politikerinnen hielten das Vorhaben parteiübergreifend auf der politischen Agenda, selbst als der Senat die Idee zunächst ablehnte.
Trotz verhaltener Unterstützung in den frühen Phasen seiner Umsetzung gewann das Projekt an politischer Dynamik. Im März 2023 kündigte Präsident Emmanuel Macron offiziell an, die Reform im Namen der Regierung vorantreiben zu wollen. Daraufhin wurde eine einheitliche Fassung des Vorschlags erarbeitet, die Anfang 2024 schließlich von beiden Parlamentskammern angenommen wurde.
Mélanie Vogel sieht in diesem Erfolg mehr als nur ein rein juristisches Update. „Diese Entscheidung ist eine wichtige Lektion für unsere Demokratie: Eine Idee, die in der Gesellschaft von der Mehrheit getragen wird, kann sich auch dann durchsetzen, wenn eine Institution sie anfangs nicht befürwortet“, sagte sie dem Fernsehsender „Public Sénat“. Für die Senatorin ist der Beschluss eine „außergewöhnliche Botschaft an alle Frauen, die die Folgen der Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs erlebt haben, sowie an jene, die sich diesem Schrecken niemals aussetzen möchten“.
Der Weg dorthin war keineswegs konfliktfrei. Konservative Parlamentsmitglieder und kirchliche Vertreter*innen äußerten lautstarke Zweifel: Einige sprachen von einer „Ideologisierung der Verfassung“, andere von einem überflüssigen Signal in einem Land, in dem das Recht auf Abtreibung bereits gesetzlich geregelt sei. Vogel begegnete den Vorbehalten mit klaren Worten: „Sie haben verloren. Es ist vorbei. Nie wieder werden sich die Kritiker eine Gesellschaft in Frankreich vorstellen können, die sich gegen das Recht auf Abtreibung stellt.“

„Die Freiheit der Frau“ – und was das bedeutet
Fast fünf Jahrzehnte lang regelte in Frankreich das sogenannte Veil-Gesetz von 1975 den Zugang zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen: Benannt nach der damaligen Gesundheitsministerin Simone Veil, die als Holocaust-Überlebende und überzeugte Europäerin zu einer Symbolfigur für Frauenrechte wurde. „Nach diesem Gesetz konnten Abtreibungen ohne medizinische Gründe und bis zum Ende der zehnten Schwangerschaftswoche von einem Facharzt in einer geeigneten Krankenhauseinrichtung durchgeführt werden“, so der „Conseil d’État“, das oberste Verwaltungsgericht des Landes.
Und weiter: „Spätere Bestimmungen haben unter anderem die Frist, innerhalb der Schwangerschaftsabbrüche möglich sind, auf 14 Wochen festgelegt. Die für Minderjährige gestellten Bedingungen wurden gelockert und eine vollständige Übernahme der Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs und der damit verbundenen Untersuchungen durch die Krankenversicherung eingeführt.“
Diese Gesetze können jedoch leicht geändert oder eingeschränkt werden, wenn sich politische Mehrheiten verschieben. Durch die Aufnahme in die Verfassung wird der Schutz des Abtreibungsrechts verstärkt, denn um diese Garantie wieder abschaffen zu können, wäre eine deutliche parlamentarische Mehrheit oder ein Referendum notwendig. Eventuelle Rückschritte sind somit in Zukunft zwar nicht unmöglich, jedoch aber stark erschwert.

I Foto: Unsplash
Ein wichtiges Signal
Frankreichs Entscheidung, das Recht auf Abtreibung in seiner Verfassung zu verankern, fällt in eine Zeit, in der immer mehr Länder diese Ermächtigung stark einschränken. In den USA etwa hob das oberste Gericht 2022 das zuvor verfassungsmäßig garantierte Recht auf Abtreibung auf. Dieses Recht war 1973 mit dem Urteil Roe v. Wade etabliert worden. Die Aufhebung führte zu zahlreichen bundesstaatlichen Verboten und erschwert seitdem den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen für viele Frauen deutlich.
Auch in Polen wurden seit 2020 die Rahmenbedingungen für legale Abtreibungen drastisch verschärft. Heute gilt in dem Land eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa, das Abbrüche von Schwangerschaften fast vollständig verbietet. Vor diesem Hintergrund gilt Frankreichs Schritt als bewusste Abgrenzung zu diesen Entwicklungen. Mélanie Vogel spricht von einer Entscheidung, die „alle Frauen auf der Welt“ erreichen und ihnen zeigen soll, „dass es einen Weg gibt – einen Weg des Fortschritts und der Hoffnung, der möglich ist, wenn die Gesellschaft mobilisiert wird“.
Vor allem die rechtliche Sicherheit hat sich für die Betroffenen deutlich verbessert. Gerichtliche Versuche, die Abtreibungsregelungen einzuschränken, wurden mehrfach abgelehnt. Im Gesundheitssystem wurden erste Initiativen ergriffen, um den Zugang zu Abtreibungen insbesondere in ländlichen Gebieten zu erleichtern. So fördert die Regierung verstärkt mobile Beratungs- und Behandlungsangebote und erweitert die Ausbildung von Fachpersonal. International hat Frankreichs Schritt eine starke Signalwirkung: Mehrere europäische Länder, darunter etwa Spanien und Belgien, prüfen aktuell ähnliche Initiativen.
Recht allein schafft noch keine Gerechtigkeit
Trotz der verfassungsrechtlichen Absicherung bleibt der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen vielerorts noch schwierig. In vielen ländlichen Départements und den französischen Übersee-Gebieten gibt es kaum Kliniken oder medizinisches Personal, das Abbrüche vornimmt. Der Sozialausschuss des Senats hat im Oktober letzten Jahres darauf hingewiesen, das in etwa sechs der insgesamt 18 Regionen Frankreichs ein Zugang zu Abtreibungen nur mit mehr als einer Stunde Fahrzeit möglich ist.
Auch lange Wartezeiten bleiben ein Problem. Die durchschnittliche Zeit bis zu einem Termin betrug laut dem Gesundheitsministerium im letzten Jahr durchschnittlich sieben Tage, in manchen Départements sogar zehn oder mehr – deutlich mehr als die eigentlich empfohlenen fünf Tage. Für Kontroversen sorgt zudem die sogenannte doppelte Gewissensklausel: Sie erlaubt es Ärzt*innen nicht nur, eine Abtreibung aus persönlichen oder moralischen Gründen abzulehnen, sondern auch, Patientinnen ohne verpflichtende Weiterleitung an andere Stellen abzuweisen.
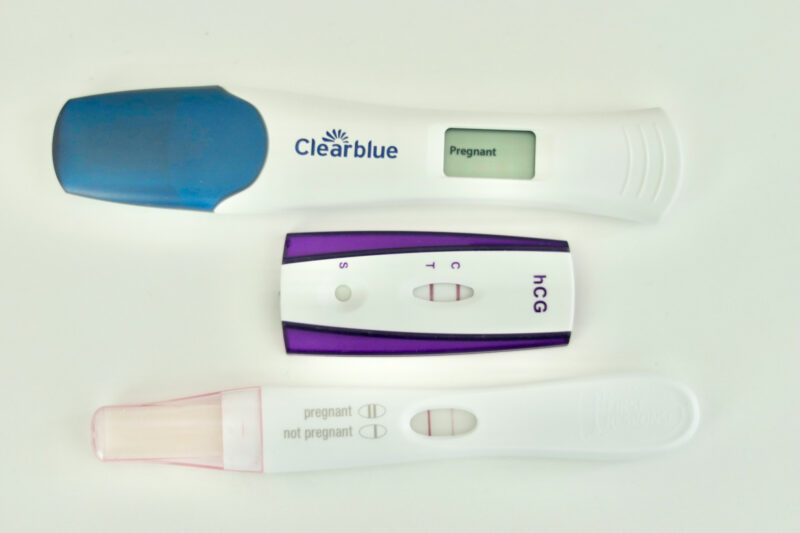
Zwischen Freiheit und Verteidigung
Menschenrechtsorganisationen wie das „Planning Familial“ kritisieren, dass diese Praxis den Zugang faktisch behindere und zu unnötigen Verzögerungen führe, die für Betroffene psychisch und gesundheitlich belastend sein können.
Auch in der Gesellschaft gibt es Widerstand. Während die Mehrheit der Bevölkerung das Abtreibungsrecht unterstützt, kämpfen konservative und religiöse Gruppen weiterhin dagegen an, etwa durch Onlinekampagnen und gezielte Desinformationen. Vereinzelt berichten Beratungsstellen von wachsendem Druck auf Mitarbeitende oder Protestaktionen vor Kliniken.
Frankreich hat mit seiner Reform längst nicht alle Herausforderungen gelöst, aber ein klares Signal gesendet: Reproduktive Rechte sind kein verhandelbares Privileg, sondern ein verfassungsrechtlich geschütztes Gut. Allein im Jahr 2023 wurden in Frankreich über 243.000 Abtreibungen durchgeführt. Etwa jede dritte Schwangerschaft endete mit einem Abbruch.
Diese Zahlen zeigen, welche zentrale Rolle das Thema für die Gesundheitsversorgung und das Leben vieler Frauen darstellt. Das Recht auf Abtreibung gilt zunehmend als Gradmesser für den Zustand liberaler Gesellschaften. Wo es gewährt und geschützt wird, sind häufig auch andere Grundrechte gefestigt. Wo es eingeschränkt wird, gerät oft auch die Demokratie selbst unter Druck.

Du magst unsere Geschichten über inspirierende Frauen weltweit und willst uns AKTIV unterstützen? Darüber freuen wir uns! Entweder wirst du ab 5 Euro im Monat Mitglied bei Steady (jederzeit kündbar) oder lässt uns eine Direktspende zukommen. Wir sagen: Danke, dass du deinen Beitrag leistest, damit guter Journalismus entstehen und wachsen kann.